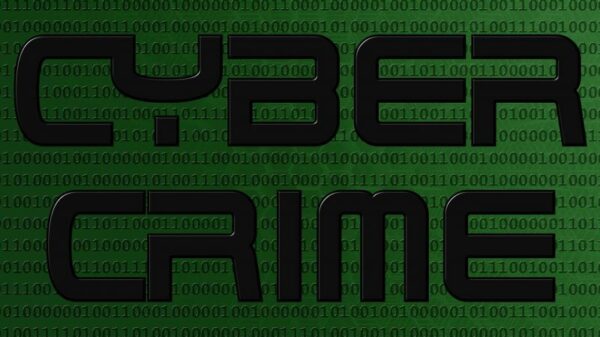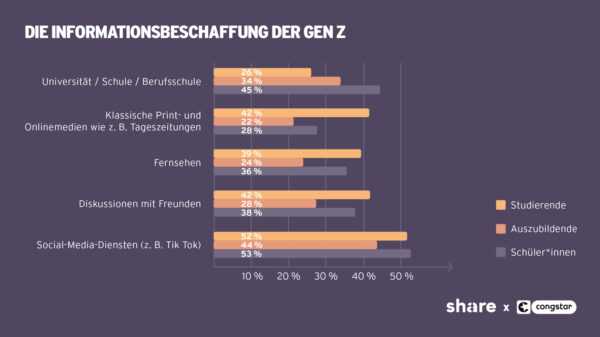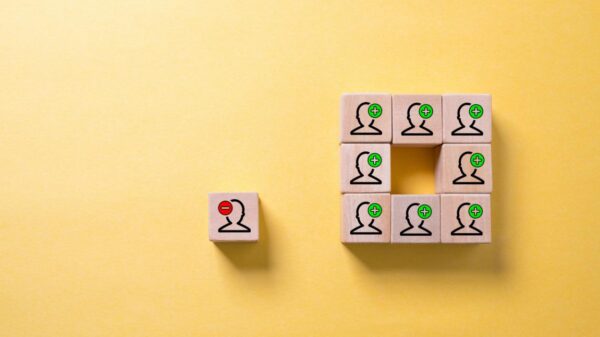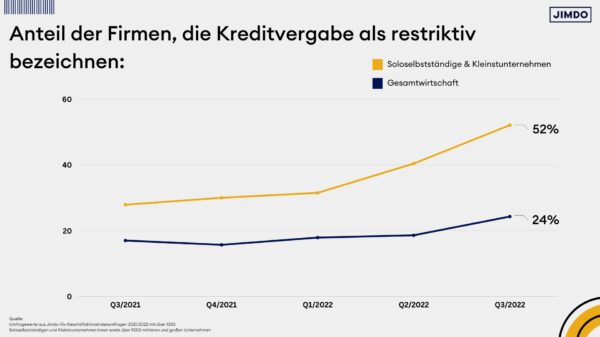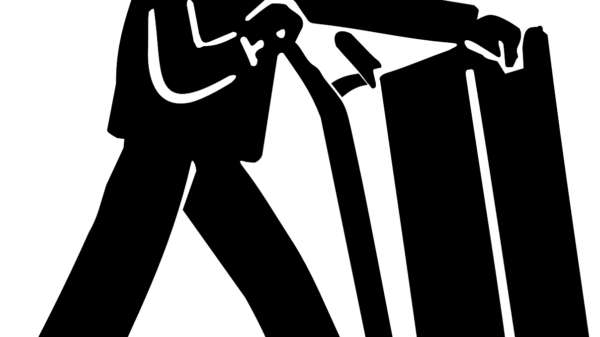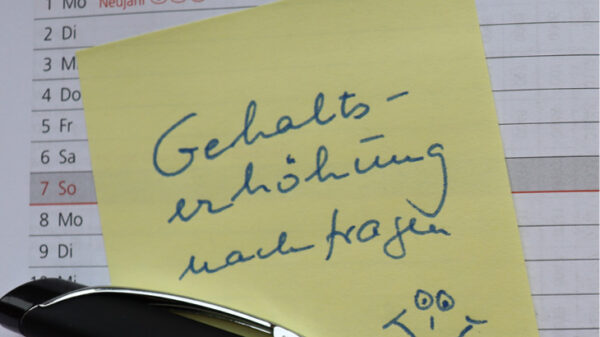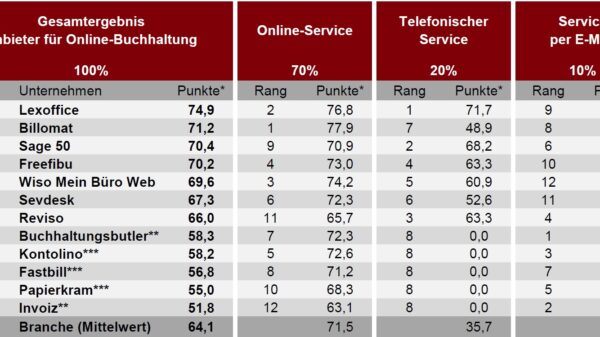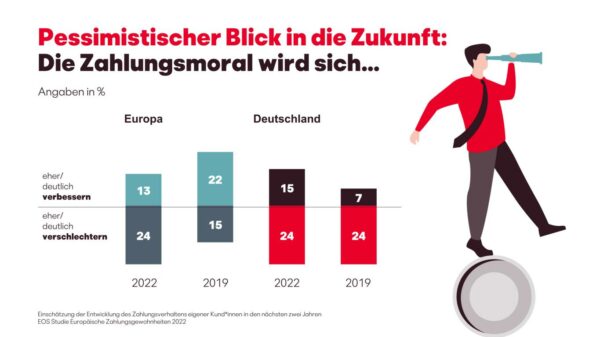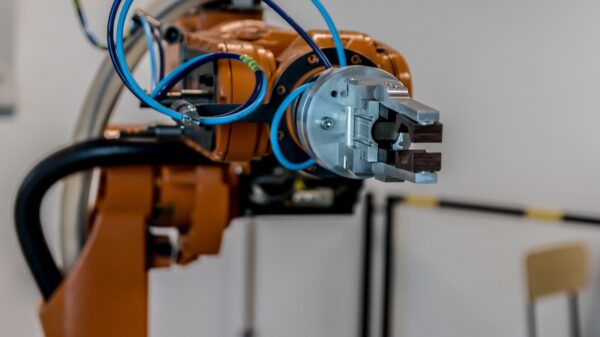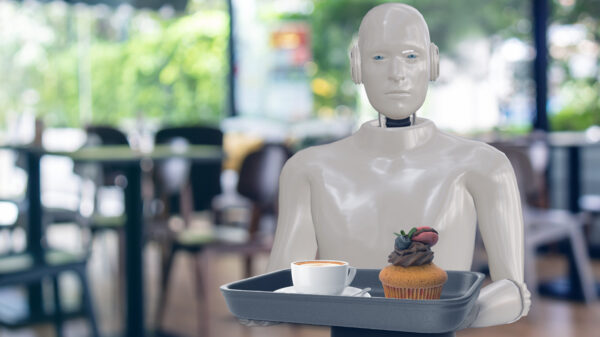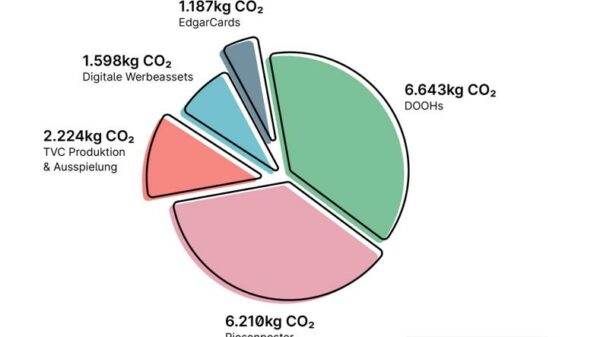In einer Woche Israel kann man an der Mauer klagen, im Toten Meer mit den Armen rudern, im Kibbuz lernen, dass Sozialismus nur mit Geld funktioniert und dass die Palästinenser, die im Juni seit 50 Jahren unter israelischer Militärbesatzung stehen, mit 70 Litern Trinkwasser pro Tag und Kopf schnell mal auf dem Trockenen sitzen.
Meine letzte Gruppenreise im Bus liegt Jahrzehnte zurück und die nächste hatte ich eigentlich für mein letztes Lebensachtel ins Auge gefasst. Wenn da nicht das Angebot einer Inforeise nach Israel gekommen wäre für so genannte Multiplikatoren aus Kirche, Politik und Bildung.
Da ich mit einem solchen Multiplikator verheiratet bin, klinkte ich mich als Begleitung bei Tour mit Schanz ein und landete inmitten einer 38-köpfigen Gruppe, die gefühlt aus lauter Pfarrern und Diakonen bestand. Von den täglich angesetzten Andachten erfuhr ich dann auch erst vor Ort.
Unsere Tour führte uns vom Kibbutz Shaar HaGolan, bei dem alle Mitglieder ungeachtet ihrer Tätigkeit oder ihres Berufs das gleiche Budget bekommen und der es sogar bis zum Börsengang der eigenen Fabrik geschafft hat, hoch zu den Golanhöhen, dann runter an den See Genezareth zu den Wirkstätten Jesu auf dem Berg der Seligpreisungen (Bergpredigt) und nach Tabgha (Brotvermehrung) bis nach Nazareth (Verkündigung des Erzengels Gabriel).
Taufe im Jordan
Wir sahen zu, wie chinesische Christen in Qasr al-Yahud im Jordan ganzkörpergetauft wurden – nur wenige Meter von jordanischen Soldaten auf der anderen Flussseite entfernt. Wir schlenderten durch die Kreuzfahrerstadt Akko, steckten uns ein Olivenzweiglein im Garten Gethsemane ein und standen auf dem Tempelberg vor dem Felsendom und der El-Aqsa-Moschee, beide von Muslimen streng bewacht. Gruppenfotos mit Anfassen untersagt.
Wir badeten im tiefsten Punkt der Welt im Toten Meer, fuhren mit einer Seilbahn auf die Felsenfestung Masada, die Herodes am Rande des Toten Meeres zwischen 37 und 4 v. Chr. hatte errichten lassen. Dorthin hatten sich nach der Zerstörung Jerusalems 1.000 jüdische Aufständische verschanzt. Nach zweijähriger Belagerung nahmen die Römer die Festung im Jahr 73 zwar ein, aber oben auf dem Felsplateau angekommen, fanden sie niemanden mehr vor. Die Männer hatten ihre Frauen und Kinder in den Abgrund gestoßen und sich dann vermutlich gegenseitig ermordet, da Selbstmord bei den Juden strengstens verboten ist. Noch heute gehört der Satz „Masada darf nie wieder fallen“ zum Fahneneid der israelischen Soldaten.
Die Fronten in den Köpfen
Apropos Soldaten: Man sieht Männer und Frauen mit Maschinenpistolen bewehrt natürlich deutlich häufiger als am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Sie stehen auf der Via Dolorosa in Jerusalem und an den Grenzposten zu den palästinensischen Gebieten. An Mauern und Stacheldraht herrscht ebenfalls kein Mangel. Wie die Fronten in den Köpfen verlaufen, dafür bekommt man bei den geplanten Begegnungen mit Einheimischen ein Gespür, die bei den Tour mit Schanz-Reisen zum Programm gehören.
Wir trafen auf eine christliche Palästinenserin und deren Sohn in Bethlehem. Sie beklagten, dass die Palästinenser noch immer nur 4 Prozent statt der vertraglich festgelegten 22 Prozent des Landes im 50. Jahr der Besatzung hätten und sie nur zu Fuß die Grenze nach Israel passieren dürften. Ein deutscher Hydrogeologe, der seit über 20 Jahren in Palästina lebt, prangerte die schlechte Wasserversorgung in den besetzten Gebieten an.
Eine Siedlerin aus Köln studiert in Jerusalem, lebt im Westjordanland in einem Wohncontainer und hofft auf eine offizielle Baugenehmigung. Eine 57-jährige Israelin, ebenfalls in Köln geboren, trat als Jugendliche in die zionistische Bewegung ein und wanderte kaum volljährig nach Israel aus. Sie erzählte uns von den Ängsten, die jede jüdische Familie durchmacht, wenn ihre Kinder zum Militärdienst eingezogen werden, die Jungen für drei, die Mädchen für zwei Jahre.
Diese Treffen gehören für mich zu den nachhaltigsten Reiseeindrücken. Wenn man davon absieht, dass ich vor der Knesset eine Glasscheibe übersah und mir darum eine blutige Nase holte. Das Sicherheitspersonal war sofort zur Stelle, forderte mich nachdrücklich auf, in einem Rollstuhl Platz zu nehmen und fuhr mich – nicht ohne meine Bauchtasche durch den Sicherheitscheck laufen zu lassen – zum medizinischen Dienst, wo mich ein freundlicher Arzt untersuchte und mir erzählte, dass sein Sohn in Deutschland studiere. Als ich nach der Stadt fragte, schüttelte er bedauernd den Kopf und sagte: Wie die heiße, wisse er nicht.
Susan Tuchel